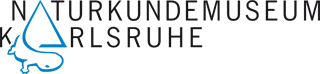Bläulinge an Jagst und Kocher: Verbreitung, Ökologie, Schutz

Projektgebiet in der Jagst-Kocher-Region

Alexis-Bläuling auf Blütenstand einer Esparsette

Kreuzdorn-Zipfelfalter auf einer Dostblüte

Männchen des Großen Feuerfalters

Raupe des Alexis-Bläulings an Tragant-Blüte mit Ameisen

Raupe des Argus-Bläulings mit Schwarzer Wegameise

Wirtsameisen (Myrmica sp.) der Ameisenbläulinge an Fraßköder
In einem faunistisch bisher nur wenig untersuchten Gebiet, dem Bereich von Jagst und Kocher im Nordosten Baden-Württembergs, wurden zehn gefährdete Bläulingsarten im Hinblick auf ihre Verbreitung und ihre regionalen Lebensraumansprüche studiert. Die mit Ameisen vergesellschafteten Bläulinge (sog. Myrmekophilie) zeigen enge ökologische Vernetzungen zwischen Raupen, spezifischen Wirtspflanzen und Ameisenpartnern, weshalb sie auf Umwelteinflüsse besonders sensibel reagieren. Die Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-Württembergs (
LDS-BW) dokumentiert deutliche Bestandsrückgänge vieler Bläulingsarten in neuerer Zeit. Hauptziel des Projekts war es, durch erweiterte regions-spezifische Kenntnisse über die Biologie der Präimaginalstadien (Eiablage, Fraßpflanzen, Ameisenpartner) die Grundlagen zu verbessern, diese Arten bei Biotop- und Landschaftspflege angemessen zu berücksichtigen.
Ameisen-Assoziationen mit einer fakultativen Symbiose (Raupe an der Nahrungspflanze mit Ameisengarde) wurden bei zwei Echten Bläulingen beobachtet:
Alexis-Bläuling (
Glaucopsyche alexis) und
Esparsetten-Bläuling (
Polyommatus thersites). Bei diesen Arten werden die Raupen häufig von verschiedenen Ameisenarten besucht, wobei die Ameisen Futtersekret erhalten und die Raupen einen gewissen Schutz durch die Ameisen genießen. Beim
Zwerg-Bläuling (
Cupido minimus) ist Ameisenbesuch aus anderen Regionen bekannt, wurde in der Jagst-Kocher-Region aber nicht registriert. Der
Große Feuerfalter (
Lycaena dispar) ist einer der wenigen Feuerfalter, bei dem Ameisen-Assoziationen berichtet wurden, was in dieser Studie gleichfalls nicht festgestellt werden konnte. Dagegen konnte beim
Kreuzdorn-Zipfelfalter (
Satyrium spini) die Vergesellschaftung mit Ameisen vor allem kleinerer Raupen an niedrigen Kreuzdorn-Pflanzen erstmals umfangreich dokumentiert werden.
Im Gegensatz dazu stehen die Raupen der obligat myrmekophilen Bläulinge in so starker Abhängigkeit zu ganz bestimmten Ameisenarten, dass sie ohne deren Anwesenheit nicht eigenständig überleben könnten. Der
Argus-Bläuling (
Plebejus argus) ist in der Jagst-Kocher-Region auf die Schwarze Wegameise (
Lasius niger) angewiesen. Im Falle der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge leben die Raupen zunächst in den Blüten des Großen Wiesenknopfs und ab dem 4. Larvenstadium parasitisch in den Nestern ihrer Wirtsameisen (Gattung
Myrmica), wo sie sich räuberisch von der Ameisenbrut ernähren. Beim
Hellen und beim
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (
Phengaris teleius,
P. nausithous) wurden Studien zur Häufigkeit der Wirtsameisen mittels Köderfängen durchgeführt, da die direkte Beobachtung der Raupen in den Ameisennestern aus Naturschutzgründen unterbleiben musste.
Die Veränderung der Landnutzung in der heutigen Zeit ist hauptverantwortlich dafür, dass die Bestände der Insekten immer mehr zurückgehen. In der Jagst-Kocher-Region leiden die Magerrasen der Talhänge unter Verbuschung wegen der Aufgabe traditioneller Nutzungsarten, wie z.B. Schafbeweidung. Auf den Wiesen im Talgrund findet vielmehr eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung statt (zunehmende Düngung, erhöhte Mahdfrequenz). Anhand der Projektergebnisse wurden Erhaltungsmaßnahmen vorgeschlagen, die zusammen mit den Landschaftspflegeverbänden, den Naturschutzbehörden und dem ehrenamtlichen Naturschutz in der Region umgesetzt werden sollen.
Das in den Jahren 2017 bis 2019 durchgeführte Projekt wurde gefördert durch die
Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg (Proj.-Nr. 73-8831.21/546 91-1705L).