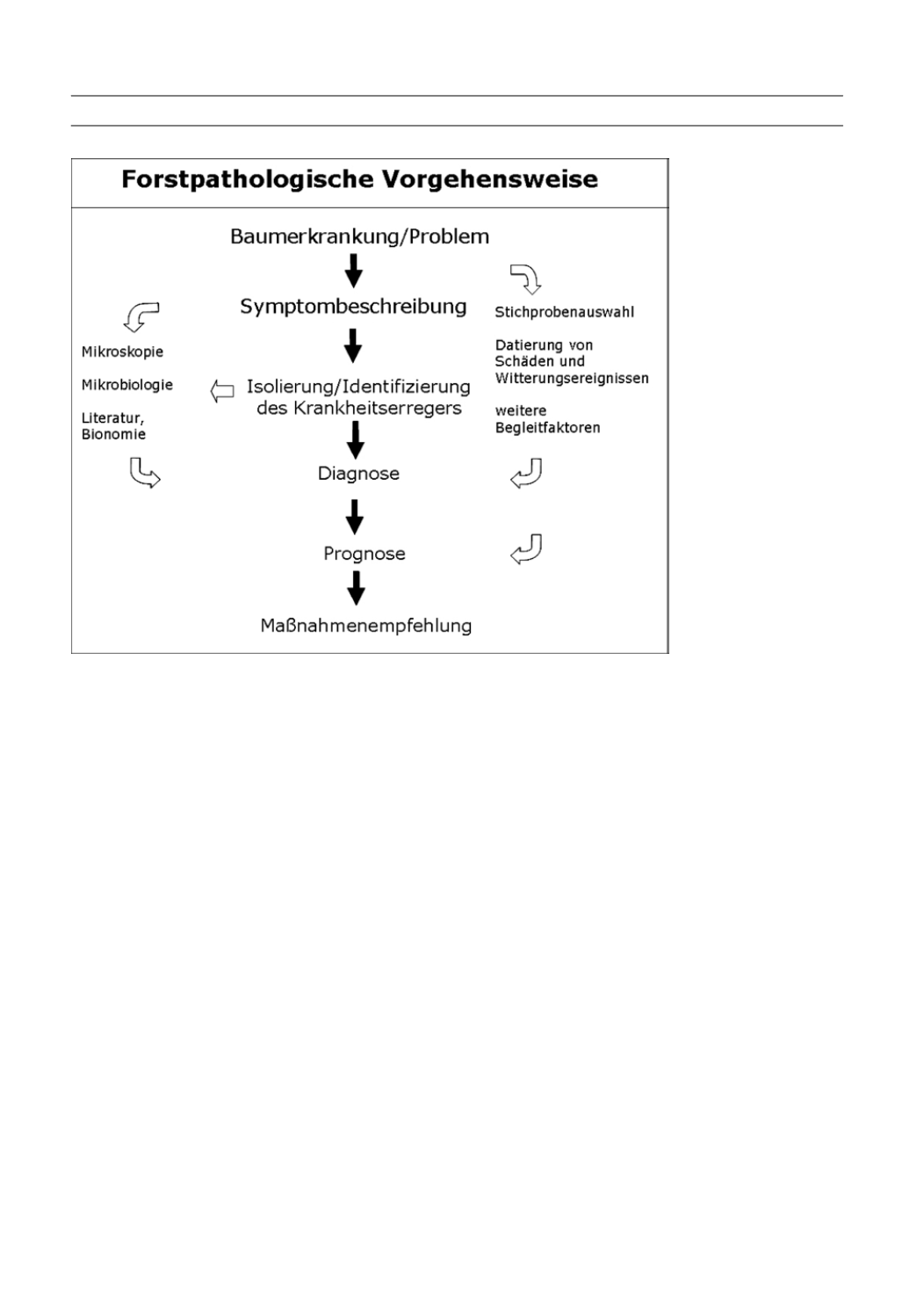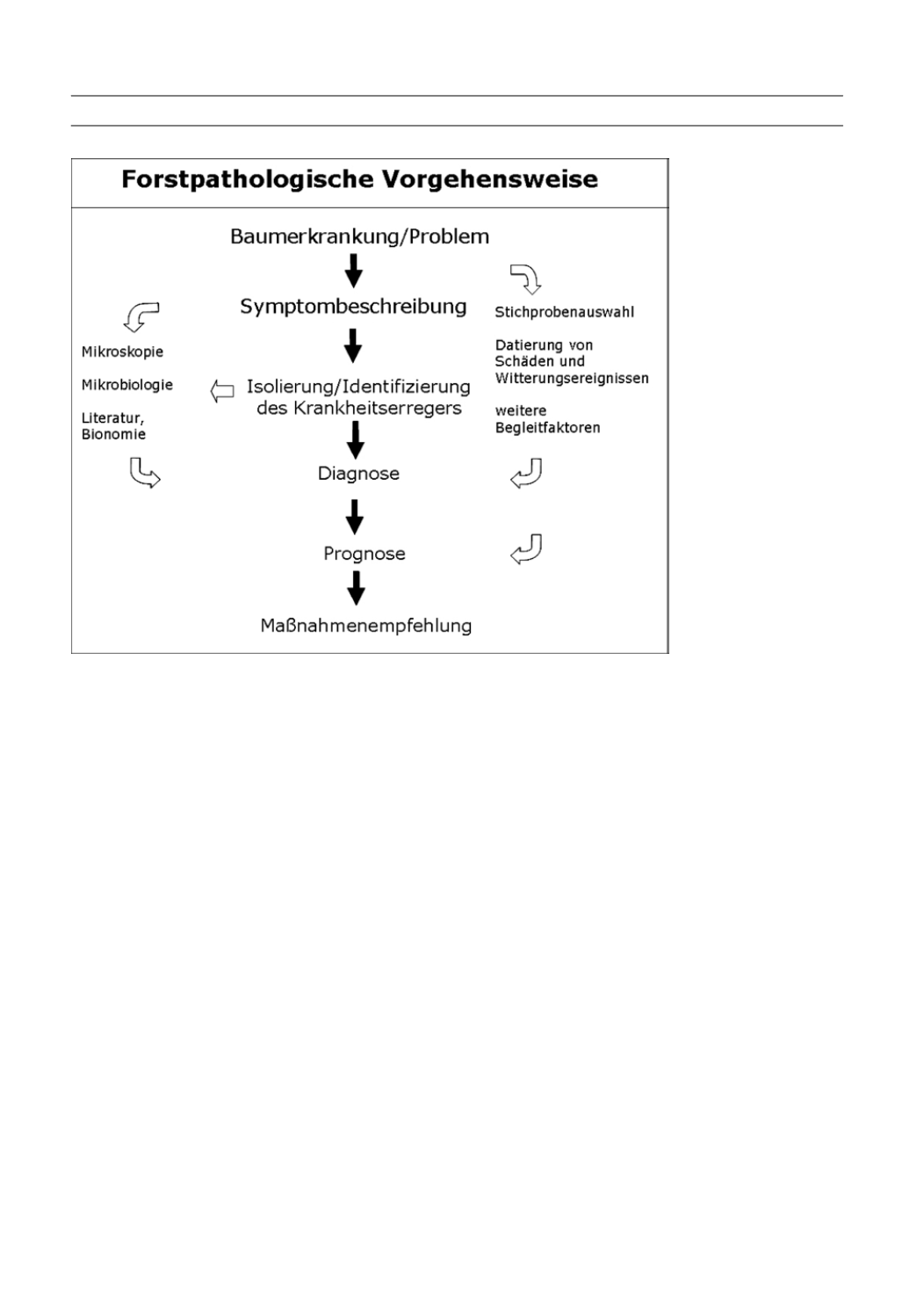
240
andrias, 19
(2012)
gern und die evtl. je nach Baumart und Befallsort
unterschiedlichen Baumreaktionen führen zu ei-
ner hohen Vielfalt von Symptomen. Andererseits
können auch unterschiedliche Schadfaktoren zu
sehr ähnlichen Symptomen führen. Beispielswei-
se wird in der Praxis oft die Stockfäule durch den
Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum s.l.)
und die Wundfäule durch den Blutenden Schicht-
pilz (Stereum sanguinolentum) verwechselt. Auch
ähneln sich Überwallungsstrukturen an Buchen-
rinde nach dem Befall durch den Kleinen Buchen-
borkenkäfer Taphrorychus bicolor mit den Baum-
reaktionen bei Buchenkrebs (Erreger: Neonectria
ditissima). Bei Verwechslungen kommt es zu un-
präzisen oder falschen Schlussfolgerungen.
Ein weites Feld sind unspezifische Blatt- oder Na-
delverluste, die oft zu Fehlinterpretationen Anlass
geben, wenn keine näheren Untersuchungen ge-
macht werden. Auch greifen Praxisversuche oft
zu kurz, wenn wesentliche biotische oder abio-
tische Einflussfaktoren ignoriert werden. Erfolg
oder Misserfolg von Maßnahmen werden durch
forstpathologische Begleitung besser erklärlich.
Die möglichst präzise Erfassung der patholo-
gischen Strukturen und die Art und Lokalisati-
on der Defekte lassen meist erkennen, ob be-
stimmte Symptome Teil des zu bearbeitenden
Problems sind oder zufällig oder sekundär hin-
zugekommen sind. Diese unter dem Einfluss von
biotischen oder abiotischen Faktoren entstan-
denen pathologischen Strukturen an Gehölzen
sind sehr vielfältig und wurden umfassend von
F
ink
(1999) analysiert und dargestellt.
Der Symptombeschreibung muss die Identifi-
zierung des Krankheitserregers folgen. Dies ge-
schieht in der Regel anhand von Pilzfruchtkör-
pern, lichtmikroskopisch, durch Isolierung und
Hinzuziehung von mikrobiologischen Vergleichs-
kulturen oder zunehmend auch durch molekular-
biologische Techniken. Durch die Identifizierung
des Erregers bis zur Art ist eine genauere Ein-
schätzung des pathogenen Potentials möglich,
ferner Angaben zum Wirtsspektrum, zum Infekti-
onsort am Baum, zur Latenzzeit, zur Art der Ver-
breitung, zu besonderen physiologischen Bedin-
gungen und Fähigkeiten sowie zu spezifischen
Wechselwirkungen mit anderen Organismen.
Die vorgefundenen Organismen müssen als Er-
reger identifiziert werden. In der klassischen Phy-
topathologie erfolgt dies durch die Erfüllung der
Koch’schen Postulate. Dies ist bei Bäumen relativ
schwierig, weil die Infektionen oft an Bedingungen
geknüpft sind, die teilweise während eines jahre-
langen Prozesses zustande kommen und daher
Abbildung 2. Forstpa-
thologischeVorgehens-
weise bei der Beratung
der Forstpraxis.